 „Die Toten bleiben jung“.
„Die Toten bleiben jung“.
Mit diesem großen Roman hat Anne Segers jenen Menschen ein literarisches Denkmal gesetzt, die für bessere Lebensbedingen der Arbeiter und gegen den aufkommenden Faschismus gekämpft haben und diesen Kampf während des Faschismus fortgesetzt haben.
Fritz Rahkob war so ein Mensch.
Geboren am 25.Juli 1885 wurde es als Bergmann 1905 in der Arbeiterbewegung aktiv; einer Arbeiterbewegung, die noch nicht in Sozialdemokraten und Kommunisten gespalten war.
Wegen einer Verwundung 1916 endete für Fritz nach 2 Jahren seine Militärzeit. Er kehrte in seinen alten Beruf als Bergmann zurück; und während der Novemberrevolution 1918 in Rotthausen war er Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats.
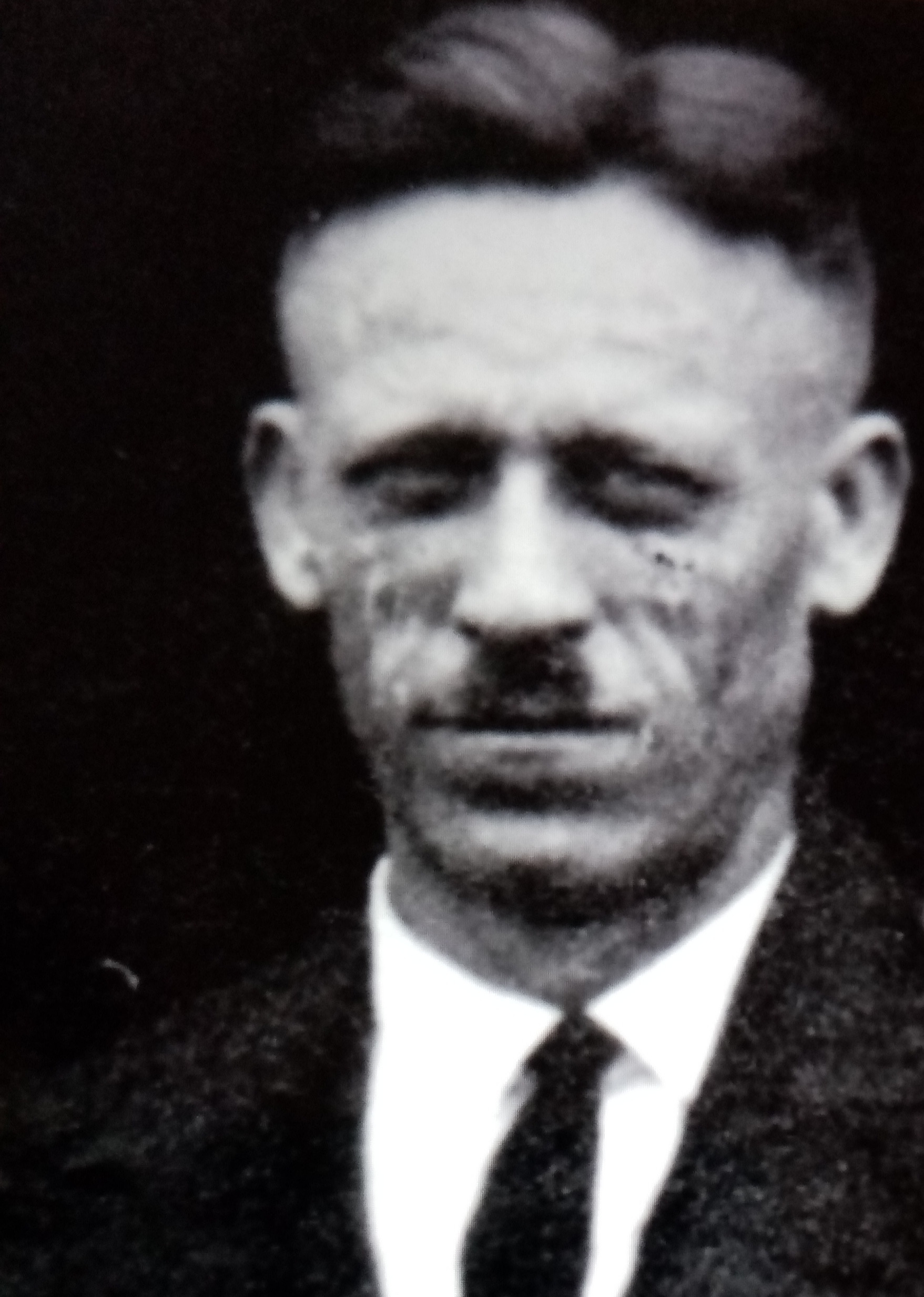 1920 wurde er Mitglied der jungen KPD. Die meisten kommunistischen Parteien gründeten sich nach dem 1. Weltkrieg als Folge des Versagens der 2. Internationalen und der SPD, die den Arbeitern vor dem Krieg versprochen hatte, alles zu tun, damit dieser Völkermord nicht stattfindet, dann aber, als der Kaiser ‚keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Deutsche‘, den Kriegskrediten und damit dem Krieg zustimmte. Und das Verhalten von Bluthund Noske, von Ebert und Scheidemann bei der Niederschlagung der Novemberrevolution war auch kein Beitrag zum Erhalt der Einheit der Arbeiterbewegung. Dies war der erste Schritt auf den Weg in den Faschismus.
1920 wurde er Mitglied der jungen KPD. Die meisten kommunistischen Parteien gründeten sich nach dem 1. Weltkrieg als Folge des Versagens der 2. Internationalen und der SPD, die den Arbeitern vor dem Krieg versprochen hatte, alles zu tun, damit dieser Völkermord nicht stattfindet, dann aber, als der Kaiser ‚keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Deutsche‘, den Kriegskrediten und damit dem Krieg zustimmte. Und das Verhalten von Bluthund Noske, von Ebert und Scheidemann bei der Niederschlagung der Novemberrevolution war auch kein Beitrag zum Erhalt der Einheit der Arbeiterbewegung. Dies war der erste Schritt auf den Weg in den Faschismus.
Seit der Eingemeindung Rotthauses 1924 nahm Fritz an den Arbeiterkämpfen in Gelsenkirchen teil, wurde Mitglied der RGO, der der KPD nahestehenden Gewerkschaft.
Ein schwerer Arbeitsunfall zwang ihn, die Arbeit im Bergbau aufzugeben.
Bei der kommunistischen Tageszeitung „Ruhr-Echo“ fand er Arbeit, erst als Kassierer, dann im Versand.
Nach der Machtübernahme der Faschisten wurde Fritz Rahkob von 1933 bis 1938 von ihnen in Schutzhaft genommen. Ein Schicksal, das der mit vielen seiner Genossen teilte.
Seine Ehefrau Emma beteiligte sich während der Haft ihres Mannes aktiv am Widerstand und wurde dafür am 20. November 1934 zu 2 ½ Jahren Zuchthaus verurteilt.
Nach seiner Haftentlassung fand Fritz Arbeit bei einem Düsseldorfer Bauunternehmer und er lernte in dieser Zeit Franz Zielasko kennen.
Zielasko hatte einen bewegten Lebenslauf:
1918 Eintritt in die USPD
1920 kämpfte er in den Gladbecker Verbänden der „Roten Ruhrarmee“
1922 nach der Auflösung der USPD Eintritt in die SPD
1926 oder 1927 Eintritt in die KPD
Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit emigrierte er 1932 in die SU.
1936 ging er zusammen mit 5000 Deutschen nach Spanien und kämpft dort in den Internationalen Brigaden bis 1939 gegen die spanischen Faschisten.
Danach ging er zurück in die SU.
Die KPD hatte sich schon vor dem Verbot 1933 auf die Illegalität vorbereitet und versucht, auch während des Faschismus die Verbindung unter den Genossen/innen aufrechtzuerhalten. 1943 unternahm die KPD den letzten großen Versuch im Ruhrgebiet den Widerstandskampf in dieser für die Kriegsrüstung so wichtigen Region wieder zu intensivieren.
Also ging Franz Zielasko im März 1943 zurück nach Deutschland.
In der Überzeugung, man müsse gegen Krieg und Faschismus etwas tun, schloss sich Fritz Rahkob der Widerstandsgruppe um Franz Zielasko an.
Aber die Gruppe wurde verraten – von wem ist unbekannt. Im August 1943 wurden 45 Antifaschisten – darunter Zielasko und Rahkob verhaftet.
Zielasko wurde schon im Verhör zu Tode gefoltert.
Fritz Rahkob wurde vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode und lebenslangem Ehrverlust verurteilt. Am 24 August 1944 wurde er durch Enthauptung hingerichtet. „Eine Kugel sei für ihn zu schade“ – meinen die Nazis.
Am Tag der Hinrichtung wurde seine Frau verhaftet, die aber dann glücklicherweise vor der Deportation ins Konzentrationslager von alliierten Truppen befreit wurde.
Mit der Aufarbeitung des Faschismus hat sich der BRD sehr schwer getan und tut sich immer noch schwer – soweit sie überhaupt stattgefunden hat.
Lehren aus dem Faschismus wurden in der alten BRD kaum gezogen. Die sogenannten Entnazifizierungskomitees taten ihr Arbeit nur halbherzig. Antikommunismus war Staatsdoktrin der Faschisten. Antikommunismus wurde Staatsdoktrin der jungen BRD.
Bei der juristischen Verfolgung der Nazi-Schergen war man auf dem rechten Auge blind – wie auch anders, wurden doch die NS-Juristen im Amt belassen.
Dazu nur ein Beispiel.
Der Recklinghäuser Kriminalrat Wilhelm Tenholt galt als einer brutalsten Beamten der geheimen Staatspolizei.
In Schutzhaft genommene politische Gegner wurde von ihm misshandelt und gefoltert; für einige Häftlinge endete das Verhör tödlich.
1949 wurde Tenholt wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit verurteilt, wurde aber kurz vor dem KPD-Verbot begnadigt – mit dem Hinweis, ob man denn den gefolterten Kommunisten „alles glauben könne“.
Auch die Stadt Gelsenkirchen tat sich schwer, die Widerstandskämpfer ihrer Stadt zu ehren.
Erst 1986 – 1988 wurden nach Opfern und Gegnern des Faschismus vier Plätze benannt:
Neben dem Kommunisten Fritz Rahkob
• wurde die Sozialdemokratin Mararethe Zingler geehrt, die wegen Unterstützung ihres wegen Hochverrats zum Tode Mannes zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.
• der Priester Heinrich König machte aus seiner Distanz zum NS-Regime keinen Hehl, wurde denunziert, kam ins KZ und an ihm wurde medizinische Experimente durchgeführt, die tödlich endeten.
• Der Jude Leopold-Neuwald wurde mit seiner Familie 1942 ins Ghetto Riga deportiert, wo er und seine Frau 1944 an den Lagerbedingungen starben.
Die Namen stehen stellvertretend für den kommunistischen, sozialdemokratischen, christlichen Widerstand und Verfolgung der Juden.
„Die Toten bleiben jung“. Sie bleiben jung, weil wir an sie denken und sie Vorbild für uns sind – Sie sind und sie bleiben unvergessen.
(h.-p.thermann)
